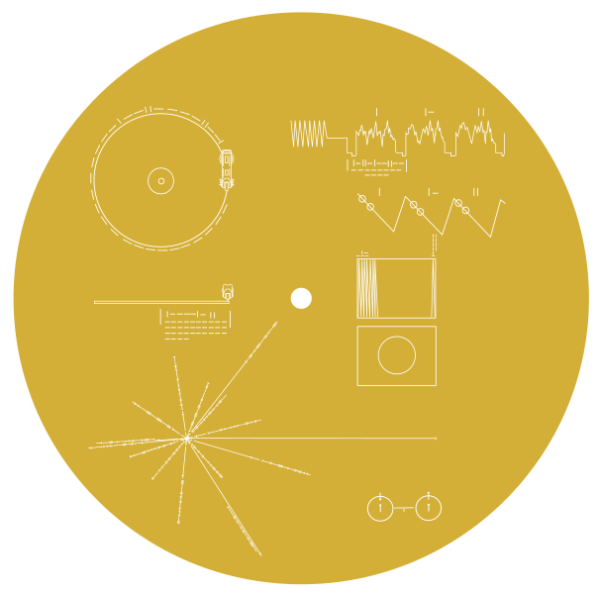Denken zwischen den Sprachen / Penser entre les langues / Thinking between Languages
Kolloquium
Denken zwischen den Sprachen / Penser entre les langues / Thinking between Languages
Jahrestagung der Max Weber Stiftung (MWS) – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, mit Beiträgen in englischer, französischer und deutscher Sprache (simultan übersetzt ins Deutsche bzw. Französische). Siehe Programm anbei.
Congrès annuel de la Fondation Max Weber – Instituts allemands de sciences humaines à l’étranger, avec des contributions en anglais, français et allemand (traduction simultanée en allemand et en français). Voir le programme ci-joint.
Annual Conference of the Max Weber Foundation – German Humanities Institutes Abroad, with contributions in English, French and German (simultaneously translated into German and French). See the programme here.
Referent:innen/Intervenant·es/Speakers: Lena Bader (DFK Paris), Barbara Cassin (Académie française/CNRS Paris), Sandra Dahlke (MWN Osteuropa), Carolin Emcke (Berlin), Mechthild Fend (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Peter Geimer (DFK Paris), Jens-Peter Hanssen (OI Beirut), Anne Lafont (EHESS Paris), Simone Lässig (DHI Washington), Elissa Mailänder (Sciences Po, Paris),Olivier Mannoni (Paris), Nicole Marion Müller (DIJ Tokyo), Christoph Neumann (OI Istanbul), Klaus Oschema (DHI Paris), Vladislav Rjéoutski (DHI Paris/MWN Osteuropa), Magdalena Saryusz-Wolska (DHI Warschau), Sebastian Schwecke (MWF Delhi), Ossnat Sharon-Pinto (Universität Ben Gourion, Be’er Scheva), Patricia Casey Sutcliffe (DHI Washington), Petra Terhoeven (DHI Rom), Jozef van der Voort (GHI London), Franz Waldenberger (DIJ Tokyo), Stefan Weidner (Berlin), Annette Wieviorka (CNRS/CSA Paris).
Deutsch (see French and English below)
Denken zwischen den Sprachen. Übersetzung als Paradigma der Geisteswissenschaften
« La langue du monde, c’est la traduction. »
Barbara Cassin
Grundlage jeder Übersetzung ist die Verschiedenheit der Sprachen. Übersetzen bedeutet, das vertraute Terrain der »Muttersprache« zu verlassen, um sich in eine andere Sprache hineinzudenken. Übersetzen ist daher mehr als Dolmetschen, mehr als die bloße Übertragung von Information. Die gelungene Übersetzung soll Form und Bedeutung des Ausgangstextes bewahren, zugleich kann sie den fremdsprachigen Text in der eigenen Sprache jedoch nicht einfach verdoppeln: es bleibt ein Rest des Unübersetzbaren. Das sich daraus ergebende Spektrum des Übersetzens hat bereits Friedrich Schleiermacher in seiner Rede Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens (1813) skizziert: Soll es Ziel der Übersetzung sein, den fremdsprachigen Text in seiner Eigenart so getreu wie möglich zu reproduzieren? Oder soll die Übersetzung sich stärker an ihren Adressaten orientieren und den Ausgangstext entsprechend modifizieren? Geht es der Übersetzung also primär um die Bewahrung und Anerkennung von Alterität und Differenz? Oder soll sie den Ausgangstext den Konventionen der eigenen Sprache anpassen, ihn vielleicht sogar dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend umformulieren?
Diese Fragen und Herausforderungen reichen längst über den engeren Bereich der Sprache hinaus. »Um von einer Sprache in eine andere zu gelangen, müssen wir von einer Welt in eine andere gelangen«, schreibt die Philosophin Barbara Cassin. In den Geisteswissenschaften wird Übersetzung daher zunehmend als Verfahren verstanden, das mit der Verschiedenheit der Sprachen auch die Verschiedenheit von Begriffssystemen, Wissensordnungen und Weltanschauungen in den Blick nimmt. Begriffe wie »Nation« oder »Freiheit« haben nicht in allen Sprachen und Gesellschaften dieselbe Bedeutung. Konzepte einer Kultur lassen sich oftmals kaum im Denkraum einer anderen Kultur reproduzieren. Kategoriale Unterscheidungen wie diejenige zwischen »Natur« und »Kultur« besitzen ebenso wenig universale Gültigkeit wie die in den indoeuropäischen Sprachen gegebene Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Neben ihrem Potenzial an Austausch und Verständigung können Übersetzungen daher auch schwerwiegende Verkürzungen vornehmen, wenn sie nämlich komplexe Sachverhalte durch Simplifizierungen ersetzen. Wie also kann die Übersetzung auch demjenigen Rechnung tragen, was sich der einfachen Übertragung entzieht? Welche produktiven Irrwege und kreativen Missverständnisse ergeben sich im Vorgang des Übersetzens? Wo verlaufen die Grenzen zwischen der Übersetzung als einer Praxis der Gastfreundschaft und der Übersetzung als Ausdruck von Überlegenheit und Macht? Übersetzen bedeutet immer auch eine Konfrontation mit den Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen der eigenen Sprache und Kultur: Ohne Kenntnis anderer Sprachen versteht man auch die eigene nicht.
Français (see English below)
Penser entre les langues. La traduction comme paradigme des sciences humaines
« La langue du monde, c’est la traduction. »
Barbara Cassin
Toute traduction se fonde sur la diversité des langues. Traduire signifie quitter le terrain familier de la « langue maternelle » pour se penser et se projeter dans une autre langue. Traduire est donc davantage qu’être interprète, davantage que faire simplement passer de l’information d’une langue dans une autre. Une traduction réussie conserve la forme et la signification du texte original, mais en même temps elle n’est pas seulement le double de ce dernier dans la langue d’arrivée : il y a toujours un reste d’intraduisible. Tout le champ de ce qui en résulte pour la traduction avait déjà été esquissé par Friedrich Schleiermacher dans sa conférence Des différentes méthodes du traduire (1813). Le but de la traduction doit-il être de reproduire le texte en langue étrangère aussi fidèlement que possible dans toute sa spécificité ? Ou bien la traduction doit-elle s’orienter davantage vers ses destinataires et modifier en conséquence le texte de départ ? La traduction entend-elle donc d’abord conserver et reconnaître l’altérité et la différence ? Ou bien plutôt adapter le texte original aux conventions de la langue d’arrivée, voire peut-être le reformuler en se conformant à chaque fois à l’esprit du temps ?
Ces questions et ces défis dépassent depuis longtemps le domaine étroit du langage. « Pour passer d’une langue à l‘autre, nous avons à passer d’un monde à l’autre », écrit la philosophe Barbara Cassin. C’est pourquoi dans les sciences humaines, la traduction est de plus en plus comprise comme un procédé qui, en même temps que la diversité des langues, prend aussi en considération la diversité des systèmes de concepts, des organisations du savoir et des visions du monde. Des concepts tels que « nation » ou « liberté » n’ont pas le même sens dans toutes les langues et toutes les sociétés. Souvent, les concepts d’une culture ne sont guère reproductibles dans l’espace mental d’une autre culture. Les distinctions catégorielles comme celle entre « nature » et « culture » ne sont pas plus universelles que les distinctions qui existent dans les langues indo-européennes entre passé, présent et futur. Ainsi, outre leur potentiel d’échange et de compréhension, les traductions peuvent également opérer des raccourcis problématiques quand elles remplacent des faits complexes par des simplifications. Comment la traduction peut-elle alors rendre compte de ce qui se soustrait à la simple transposition ? Quels errements productifs et quels malentendus créatifs peuvent-ils naître dans le processus de traduction ? Où se situe la limite entre la traduction comme pratique d’hospitalité et la traduction comme expression de supériorité et de pouvoir ? Traduire, c’est toujours aussi se confronter aux possibilités, aux conditions et aux limites de sa propre langue et de sa propre culture : sans la connaissance d’autres langues on ne comprend pas la sienne propre.
English
Thinking between languages. Translation as a paradigm in the humanities
« La langue du monde, c’est la traduction. »
Barbara Cassin
The groundwork for every translation is the heterogeneity of languages. To translate means to leave the familiar territory of the “mother tongue” in order to think one’s way into another language. Translating therefore goes beyond acting as an interpreter, beyond merely transmitting information. A successful translation ought to preserve the form and meaning of the source text, but at the same time it can’t simply duplicate the foreign-language version in one’s own tongue. The original text and the translation cannot be identical – there remains a vestige of the untranslatable. Consequently, a wide spectrum of considerations emerges around translation, outlined already by Friedrich Schleiermacher in his 1813 speech Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens: Should the aim of translation be to reproduce the foreign-language text in its specific character, as faithfully as possible? Or should the translation demonstrate a greater orientation towards its target audience, modifying the source accordingly? Is translation concerned primarily with the recognition and preservation of alterity and difference? Or should it adapt the source text to the conventions of its own language, perhaps even applying reformulations in keeping with the current zeitgeist?
The modes of translation practiced against this backdrop have long exceeded, in their stakes, the narrower area of language. “To go from one language to another, we have to go from one world to another”, writes the philosopher Barbara Cassin. In the humanities, translation is increasingly construed as a process that, along with the heterogeneity of languages, takes into account the heterogeneity of conceptual frameworks, systems of knowledge, and worldviews. Terms like “nation” and “freedom” do not have the same meaning across all languages and societies. Concepts from one culture can often hardly be reproduced in another culture’s field of thought. Categorical distinctions, such as that between “nature” and “culture”, have no greater universal applicability than does the distinction among past, present, and future in the Indo-European languages. For all their potential in facilitating comprehension, translations can also pose drastic limitations, when abstract conceptualizations are replaced with concrete statements, multifaceted connections with straightforward language of cause and effect, or intangible ideas with more manageable ones. And so, how can translation account for that which can easily elude transmission? What productive aberrations and creative misunderstandings arise in the process of translation? Where are the boundaries between translation as a form of hospitality and translation as an expression of superiority and power? Translating always means confronting the potentials, conditions, and limitations of one’s own language and culture. Without knowledge of other languages, you cannot understand your own.
Verantwortliche Person am DFK